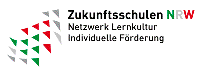Am 28. Februar eines jeden Jahres erinnert die Stadt Hilchenbach der Opfer des Nationalsozialismus.
Der Grund für dieses Datum ist, dass Elisabetha Holländer und ihr Sohn Lothar als zuletzt verbliebene Juden Hilchenbach an diesem Tag vor 82 Jahren verlassen mussten, da sie aufgefordert wurden, sich in Dortmund zu melden. Von dort wurden sie gemeinsam mit zahlreichen anderen Menschen deportiert. Ihre Reise endete im Konzentrationslager Auschwitz.
Neben Kurzansprachen von Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Heiner Giebler, dem Vertreter der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, sowie Musikbeiträgen des gemischten Chors DaChor trugen in diesem Jahr auch Schüler:innen der Klasse 10a des Gymnasium Stift Keppel zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus bei. Ihr Beitrag findet sich hier zum Nachlesen:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,
an unserer Schule, dem Gymnasium Stift Keppel, haben wir uns Anfang letzten Jahres einen ganzen Tag lang mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt.
Es fanden Vorträge und Workshops statt.
Unsere Klasse hat sich unter Leitung unseres Klassenlehrers, Herrn Dr. Galle, mit den Opfern des Nationalsozialismus im Ferndorftal beschäftigt. Nach unseren Untersuchungen sind von Hilchenbach bis Buschhütten mindestens 73 Personen Opfer der Nationalsozialisten geworden.
Es handelt sich größtenteils um Juden. Daneben finden sich aber auch Zwangsarbeiter und Kinder von Zwangsarbeitern – ausnahmslos aus Osteuropa – oder Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen.
Nur ein sehr geringer Prozentsatz hat überlebt. Die meisten starben während der Kriegsjahre in den Konzentrationslagern in Auschwitz, Sachsenhausen und Theresienstadt.
Sie können sich nicht mehr zu Wort melden, nicht mehr berichten von dem, was sie erleiden mussten, nicht mehr warnen.
Aus diesem Grund haben wir uns zur Aufgabe gemacht, an das Schicksal von Lothar Holländer und seiner Mutter Elisabetha, genannt Gerti, geborene Sonnheim, zu erinnern. Sie beide wollen wir heute zu Wort kommen lassen.
Lothar Holländer
Mein Name ist Lothar Holländer. Ich wurde am 3. September 1932 geboren – ein Kind, voller Leben, voller Träume und Hoffnungen. Ich stammte aus Siegen, aus einer Familie, die wie so viele andere ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft war, bevor Hass, Ausgrenzung und Verfolgung diese zerstörten.
Doch meine Kindheit war keine unbeschwerte. Mit dem Erstarken der Nationalsozialisten begann eine unaufhaltsame Spirale des Schreckens. Juden wurden entrechtet, isoliert und systematisch verfolgt. Für mich, für meine Eltern Willi und Elisabetha, und für so viele andere bedeutete dies das Ende eines normalen Lebens.
Im Februar 1943 wurde ich mit meiner Familie aus Siegen deportiert. Ich war gerade einmal 10 Jahre alt. Die Reise endete in Auschwitz, einem der Orte, die für immer mit Leid, Grausamkeit und Vernichtung verbunden bleiben. Dort verliert sich die Spur von mir. Man weiß, dass ich ermordet wurde – ein Kind, das nie die Chance hatte, zu leben, zu träumen, erwachsen zu werden.
Heute erinnern wir an mich, Lothar Holländer. Wir sprechen meinen Namen aus, damit er nicht in der Anonymität der Opferzahlen verblasst. Wir erinnern an das Leben, das ich hätte führen können, und an das Unrecht, das mir und Millionen anderen angetan wurde.
Doch wir gedenken heute nicht nur, um uns zu erinnern. Wir gedenken auch, um zu mahnen. Meine Geschichte und die Geschichten aller Opfer des Holocausts verpflichten uns. Sie rufen uns auf, wachsam zu bleiben gegenüber jeder Form von Antisemitismus, Ausgrenzung und Rassismus. Sie erinnern uns daran, dass unsere Gesellschaft nie wieder in Hass und Barbarei abgleiten darf.
Elisabetha Holländer
Ich bin Elisabetha Holländer, geborene Sonnheim. Von meinen Freunden und meiner Familie werde ich auch Gerti genannt.
Ich wurde am 28.5.1900 in der Pfalz geboren.
Am 2.4.1927 heiratete ich Willi Holländer. Wir zogen daraufhin hierher, nach Hilchenbach, in den Mühlenweg 281, heute 25.
Zunächst übernahm mein Mann das Geschäft seines Vaters. Er handelte mit landwirtschaftlichen Produkten wie Fell und Futter.
1935 wurde er aufgrund der Arisierung gezwungen, seinen Laden zu schließen. Juden war es fortan verboten, ein eigenes Geschäft zu besitzen oder auch nur zu betreiben. Das war für ihn persönlich, aber auch für uns als Familie sehr schwer. Damit wir über die Runden kamen, musste mein Mann als Hilfsarbeiter in zwei Siegener Firmen arbeiten.
In Hilchenbach gehörte wir bald zu letzten Jüdinnen und Juden.
Ich wurde dazu aufgefordert, mich mit meinem Sohn Lothar am 28. Februar 1943 in Dortmund zu melden. Nach Hilchenbach konnten wir nicht zurück. Wir wurden deportiert. Drei Tage später, am 3.3.1943, erreichten wir Auschwitz.
Den Menschen heute ist mein Sterbedatum nicht bekannt, aber ein Stolperstein im Mühlenweg 25 erinnert heute noch an mich und meine Familie.